Immer wieder liest man diesen Satz
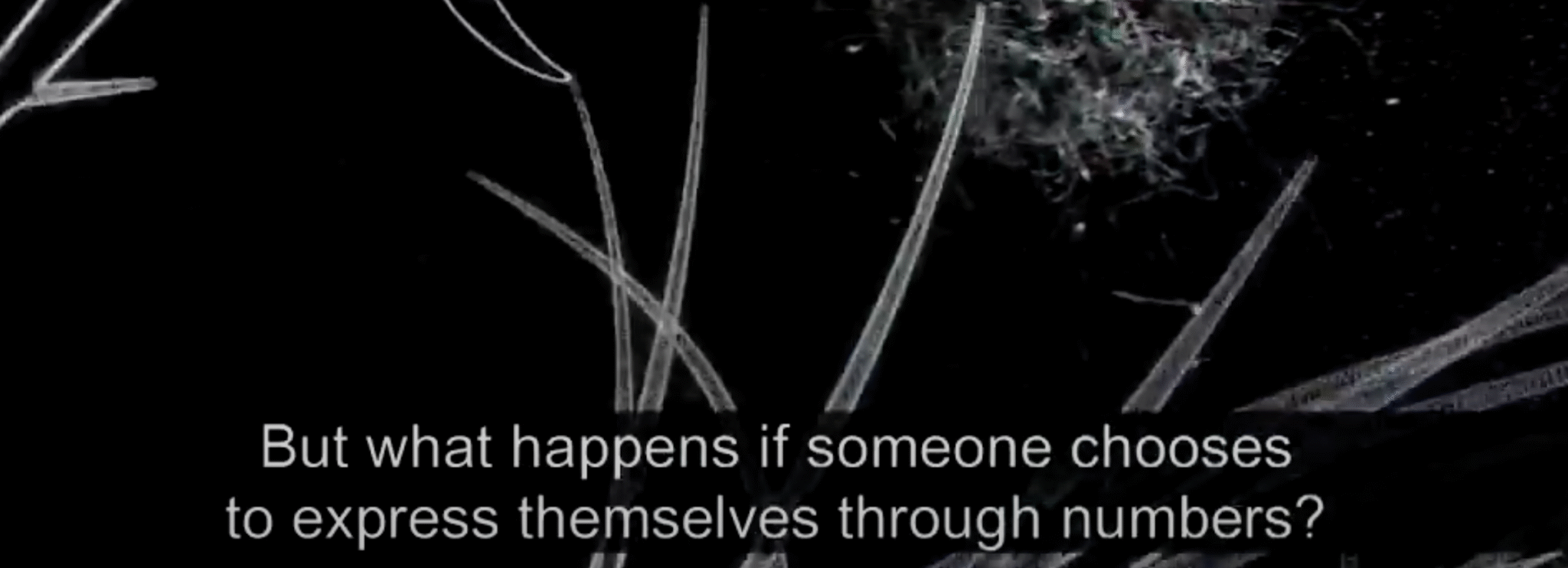
// Aus der „Dokumentation „The Art of … “ siehe unten
Die Demoscene soll sich also durch Nummern ausdrücken?
Am Anfang des Prozesses stehen Algorithmen, diese werden meist in einer Programmiersprache geschrieben und dann in Exes, ausführbaren MaschinenCode übersetzt. Dieser wird dann ausgeführt vom Computer und generiert in der Sprache der Mathematik Geometrie oder anders gesagt Grafik.
Der Prozess der Creation hat also erst einmal einen weiteren entscheidenen Schritt zwischen Macher und „Konsument“. Die alte Kulturtradition war: Der Kulturhersteller malt ein Bild (drückt sich mit Farbe aus). Dieses wird vom Betrachter angeschaut. Es besteht also ‚ein unmittelbarer‘ Zusammenhang im Bild, zwischen Betrachter* und Macher*. In der Kirche würde man sagen: Eine heilige Succession (Kontakt). All dies entfällt selbstverständlich, sobald es digital ist. Es ist quasi die analoge Maschine. Diese besteht aus Atomen, die das Bild ‚Aufrechterhalten‘ oder eben auch Teil des Auflösungsprozesses sind. Für viele geht es hier dann um „Authentizität“ und um das „Orginal“, das wichtigste Stück.
Zurück zu den digitalen Produkten, die sie – fast alle – kopierbar sind und damit per se schon Massenware sind – vergleichbar wie Bücher. Bücher nutzen zu ihrer Ausführung auch eine „Maschine“: den Menschen. Dieser übersetzt, interpretiert oder eher baut sie in der Semiose in sein eigenes Weltbild ein, wobei er eine eigentständige symbolische Kopie davon in „seinem Gehirn“ erstellt.
Die auf Computer laufenden Medien operationalisieren diesen Prozess als Turing Maschine und sind in der Lage eben direkt aus Code Geometrie zu erstellen. Einige nennen sie deswegen auch „Bildgebende Verfahren“ (Kittler und Co). Es besteht nun die Frage: Geht es in der Demoscene um die Ebene des Codes oder um die Ebene des Resultates. Was per se nicht dasselbe ist. Beim klassischen Bild fällt das in eins. Zwar drückt man sich mit Farbe aus, aber auch hier ist das Resultat ein Bild aus Farbe. Selten geht es um die Farbe an und für sich, also um das Medium.
Bei digitalen Produkten ist das im ersten Moment nicht anders. Die meisten interessieren sich bei Demos nicht für wie sie gemacht sind. Sie sehen nur die Endprodukte und staunen. Das Staunen wird erhöht, wenn dann etwa die Restriktionen dieser „Kunstwerke“ erklärt werden. Echtzeitgrafik (und -gemoetrie) und nur 4 * 1204 Bytes (auch eine Nerdbeschreibung hier). Hier zeigt sich die ‚Handwerkskunst‘ der Demoscene oder digitalen Algoscene.
Anders gesagt, die Kunst funktioniert im Kern wie in der klassischen Kunst – etwas wird ins Wahrnehmbare verschoben. Der folgende Doku-Video zeigt das deutlich:
Auch hier geht es um den Ausdruck. Statt per Körper nun neu eben per Zahlen.
Die Demoscene drückt sich konkret durch Algorithmen aus Zahlen (Digitale Universalmaschine), die Programme sind, aus, die wiederum Zahlen produzieren, die von Computern als Grafik interpretiert werden, die Menschen dann wahrnehmen.
Interessanterweise wird in der Demoscene die Algorithmen alias Zahlen gar nicht wirklich thematisiert. Sie sind Insiderinformationen, die sehr selten in SourceCodes geteilt werden, sehr selten dokumentiert sind. Writeups finden sich noch weniger. Die Zahlen also durch die sie sich „ausdrücken“ sind hier gar nicht das Ausstellungsmaterial. Sie kommen vielleicht als Diskussionsgrundlage an Demoparties unter Gleichgesinnten vor – aber sie sind letztlich verborgen. Das Argument, man könne ja den Code diassemblieren – also zurückverwandeln in Code – sticht dabei nicht wirklich. Denn zum einen ist das letztlich nur mit den Maschinensprachen möglich und zum anderen ist auch hier nichts dokumentiert.
All dies führt mehr zur Genieästhetik vergangener Jahrhunderte, wo das Genie immer grösser wurde, je weniger der Betrachter* verstand, wie die ganzen Sachen „funktionieren“ – ist in einem gewissen Sinn Antiaufklärerisch oder besser Gegenaufklärerisch (Es geht ums Staunen). Diese Auslegung wird noch dadurch gestärkt, dass die Demoscene einer weitgehend männlichen Community entstammte, der es vorallem um Bekanntheit ging innerhalb dieser Scene und fast nur da (Motivationsdesign).
Und hier finden sich dann auch Zahlen in rauen Mengen, es sind vorallem Statistiken: Wieviele Punkte, Polygone oder Anzahl Texturen. Es sind die Herausforderungszahlen. Das Gespraye von statistischem Hintergrund.
Das durch was sich die Demoscene wirklich ausdrückt – den Code – kommt wie vorher schon teilweise aufzeigt, eigentlich gar nicht vor in den Demos selbst. Es gibt fast keinen Code in den Demos selbst direkt. Die Zahlen sind nicht da, sie werden eher versteckt, verborgen. Oder sind maximal da als kurze Statments, die man nicht lesen oder verstehen kann. Im besten Fall ist dies lesbar als der Code, der sehr kurz ausgeführt wird – im schlimmsten ist es einfach Gepose.
Was vorkommt, sind natürlich die gemoetrischen Interpretationen dieser Zahlen – also digitale Potenzen in Schachbrettmustern oder rotierenden Cuben. Die Übersetzung von Code und Können in grossen massigen Scrollschriften oder komplexen Geometrien, die eigentlich nicht möglich sein sollten auf solchen Mainstream Computern wie etwa die Homecomputer.
Es gibt also fast keine Tinte, keine Buchstaben, keine Farbe alias Code, Zahlen in Demos. Sie sind „nur“ Zahlen in ihrer Entstehung aber nicht in ihrem Output in ihrer Wahrnehmung. Im Deutschen könnte man auch sagen: Die Demoscene drückt sich durch Zahlen aber nicht in Zahlen aus. Sie drückt sich durch Zahlen und Algorithmen in Echtzeit in Geometrie aus.
Selbstverständlich ist das Geschriebene hier unterkomplex. Aber irgendwo muss man anfangen. Des weiteren wurde bis hierhin absichtlich wenig Literatur zum Thema gelesen, damit die Vorstellungen zum Thema nicht vom Diskurs (defiktionalisiert als ChatGPT) geprägt sind und nochmals hingeschaut werden kann.
// Siehe dazu auch: Josef K … https://research.swissdigitization.ch/?p=3393 oder CodeDemo https://www.gamelab.ch/?p=10984