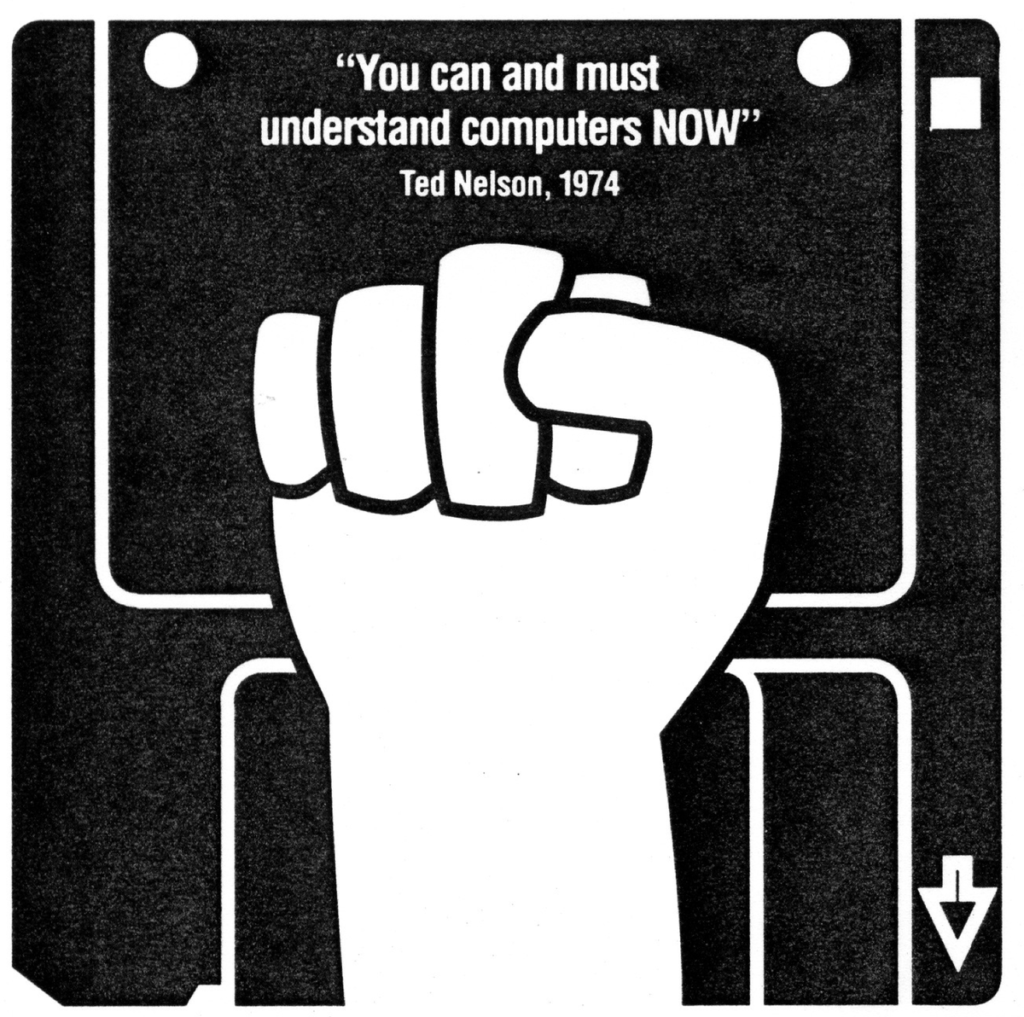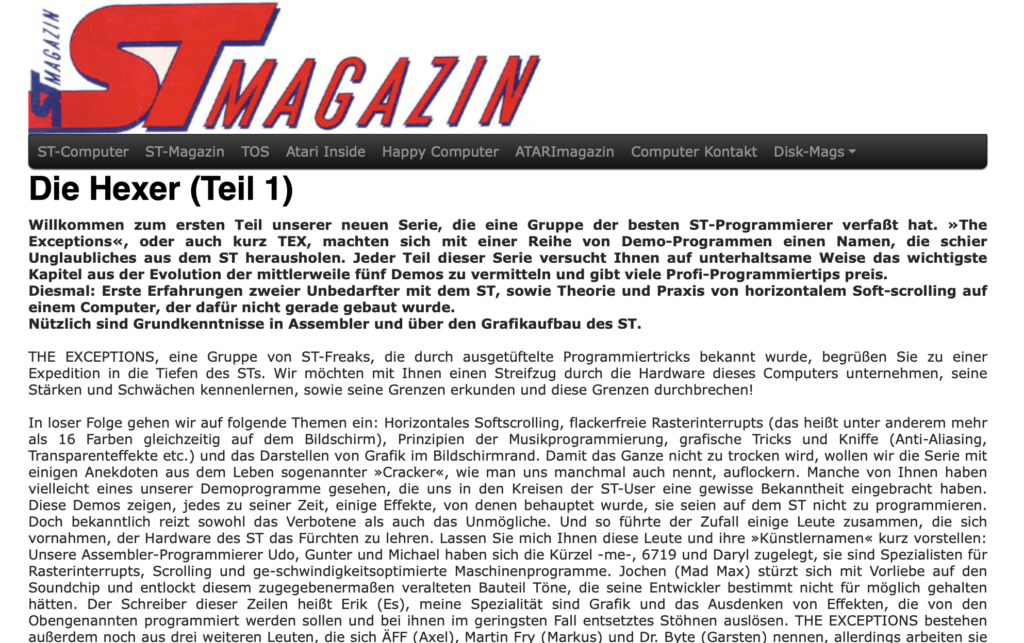Team ZHdK
Aus den mehrfachen Diskussion in Teilgebieten wird hier zusammengefasst, was bis anhin dazu vorliegt und wo weiter ‚verdichtet‘ werden könnte.
Die SemioseKaskade
Warum ist die Diskussion der Semiose bei Games interessant? Die Semiose ist in elektronischen (wie auch analogen) Games verzwickt und führt über verschiedeneste „Medienbrüche“. Auch und gerade wegen der anfänglichen ’schlechten‘ Auflösungen der Games. Man kann deswegen geradezu von einer Kaskade sprechen, die benutzt wurde, um in die Games ‚einzuführen‘ und das Lesen der Spiele zu beeinflussen. Selbstverständlich beeinflusst wiederum jeder Bereich wieder andere und kann auch zurückwirken im Sinne von: „Was genau hat das Analogartwork mit dem Game zu tun.
Arcades
Arcades wie auch Pinballs sind geradezu mit ihren „Arcadekästen“/Architektur defiktionalisierte Werbung und Einführung für das Spiels: Kasten, Sound, Aufmerksamkeitsmechaniken. Siehe dazu die Artikel von Bauer/Kato, Krummenacher (Pinball) und Suter (Missile Command).
Die Arcades besetzen dazu einen konkreten Raum in der analogen Welt und ein sozikulturelles Umfeld sind also Treffpunkte (Kocher, Ivo) – sind also ein Magic Circle für sich. Ein einzelner Kasten ist zudem ein Erlebnis – ganz im Gegensatz zu einer Konsole oder einem Computer (mehrere Spiele, Computer noch mehrfach nutzbarer). Die Universale Spielmaschine oder die Universale Turingmaschine lassen grüssen.
// Ausbau ++
Homecomputer/Consolen im Dilemma
Consolen wie auch Homecomputer verfügen nicht über diese analoge Verschmelzung von Nutzung und einem Setting. Sie sind also massiv mehr auf Inszenierung angewiesen. Gerade auch – wie bei den Arcades – wenn ganz am Anfang die Grafiken nicht gerade erkennbar sind. Darum spielen hier die Bereiche und verengenden semiotischen ‚Massnahmen‘ eine viel grössere Rolle.
Werbung und Magazin
Wie auch im Workshop vom Sommer 2023 (ZHdK) gut sichtbar – bei der Auslegeordnung – aller PowerPlay Magazine (galt damals als unabhängiges Magazin) wird schnell klar: Auf dem Titelbild wird meistens das Setting/Visualisierte Story der Spiele dargestellt und zwar für das Medium Druckmedium (100+ Dpi). Also nichts, was ein Spiel zu dieser Zeit auch nur annähernde bieten konnte (8Bit Homecomputer). Die Funktion ist dabei auch klar: So soll die Imagination des Gespielten aussehen. Sie soll also mehr sein als das Gespielte. Das Gespielte wird damit aufgeblasen und interpretiert in dem Sinne. Die Spielmechanik ist dabei minimal dargestellt im Bild (Konflikt) oder wird durch das Setting ableitbar aus dem Bild lesbar (etwa Krieg). Selbstverständlich kommen die Spiele anschliessend als Werbung (Finanzierung, Einfluss) oder als Berichte vor. Hier findet man dann auch oft den ersten Screenshot/Ingame Grafik. Da wird dann auf das Spiel eingegangen und textlich beschrieben, um was es geht, was das Gameplay/Spielmechanik ist. Und das wird in Kategorien bewertet. Dabei spielt dann hier auch eine Rolle, welche Platform wie gut aussieht etc.
Weiterlesen